Frau Stüben, Sie machen schon seit einigen Jahren Aufklärungsarbeit zum Thema Alkoholsucht bei Frauen. Wie sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie darüber in der Öffentlichkeit – insbesondere über Ihre eigene Geschichte – sprechen?
Nathalie Stüben: Ich merke, dass ich eine andere Zielgruppe anspreche als die traditionellen Angebote. Was wohl vor allem daran liegt, dass viele traditionellen Angebote eher männlich geprägt und auf Extremfälle ausgerichtet sind. Also auf Menschen, deren Suchtentwicklung sich im Endstadium befindet, wenn die Hände schon zittern, wenn Menschen schon täglich und morgens trinken müssen. Das sind aber nur eine Handvoll Prozent, wenn wir uns die Gruppe von Betroffenen anschauen. Abhängigkeit hat viele Gesichter und durchläuft viele Stadien. Ich hatte zum Beispiel bis zuletzt alkoholfreie Tage zwischen meinen Abstürzen, und ich habe auch nie gleich morgens nach dem Aufwachen getrunken. Ich war noch arbeits- und funktionsfähig, meine Fassade stand noch. Aber hinter der Fassade verbrachte ich meine Zeit halt damit, Trinkregeln aufzustellen und sie zu brechen. Freizeitaktivitäten ohne Alkohol erschienen mir sinnlos.
Ich plante meinen Alltag so, dass ich mich zwischendurch unbemerkt abschießen konnte.
Wie sah Ihr Alltag aus?
Stüben: Ich plante meinen Alltag so, dass ich mich zwischendurch unbemerkt abschießen konnte. Plante, wie ich meine Weinflaschen möglichst so zum Glascontainer bringe, dass niemand bemerkt, wie viele es schon wieder sind. Ich trank, bevor ich mich mit Freundinnen traf, damit nicht auffällt, wie viel ich trinke. Permanent verglich ich meinen Konsum mit dem von anderen, war wütend auf Kellner, wenn sie anderen mehr einschenkten als mir. Ich trank immer mehr als ich wollte. Schlief mit Männern, mit denen ich im nüchternen Zustand im Leben keinen Sex gehabt hätte. Hasste mich immer mehr für diese Dinge. Hasste mich dafür, dass ich eigentlich so viel mehr aus meinem Leben machen könnte. Nur, dass das halt in meinem ‚offiziellen’ Leben kaum jemand mitbekam. Ich war auch alkoholabhängig, aber es sah anders aus als das, was wir bei diesem Begriff klassischerweise im Kopf haben.
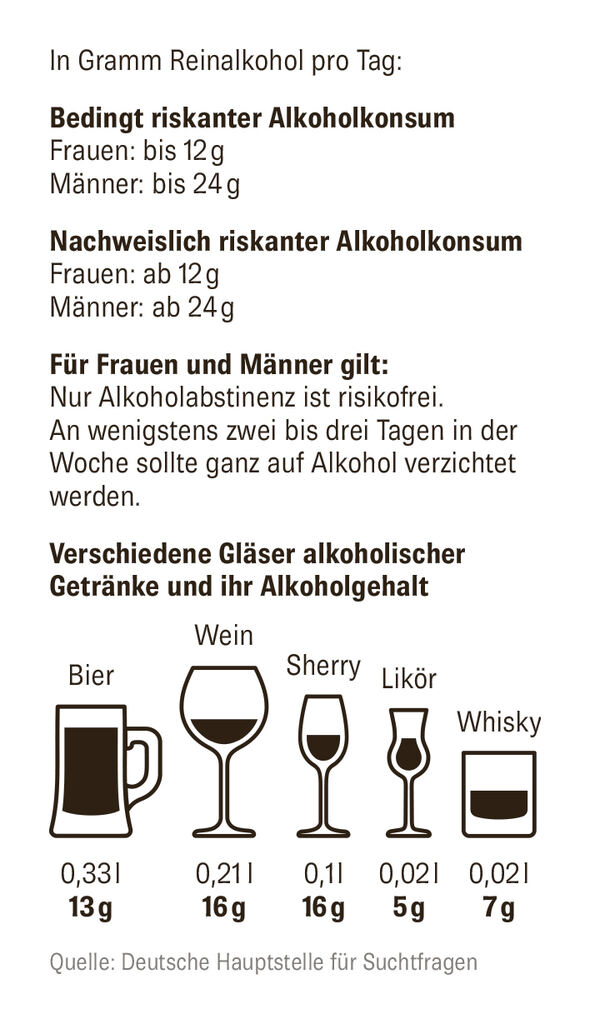
Die Statistik zeigt: Immer mehr Frauen trinken in Deutschland riskant. Welches Gefühl löst das bei Ihnen als Betroffene aus?
Stüben: Mitgefühl. Und Sorge. Denn je mehr Frauen riskant trinken, und je mehr Frauen sich regelmäßig betrinken, desto mehr Frauen werden auch in der Abhängigkeit landen. Da sind wir wieder bei den verschiedenen Stadien einer Sucht. Es ist ja nicht so, als würde sich ein Schalter umlegen, und wir sind süchtig. Alkoholabhängigkeit beginnt oft mit sogenanntem Genuss- oder Partytrinken. Mit einer Gewohnheit, aus der sich eine schlechte Gewohnheit entwickelt, aus der sich Missbrauch und – viel schneller als wir denken – eben auch Abhängigkeit entwickeln kann.
Was ist Ihre wichtigste Botschaft und das Kernelement Ihres Programms „Ohne Alkohol mit Nathalie“?
Stüben: Meine Kernbotschaft lautet: Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Das zu vermitteln, ist mir so, so wichtig. Weil ich selbst ein Leben ohne Alkohol viel zu lange mit Verzicht und einem Leben zweiter Klasse verbunden habe. Mit ewigem Kampf und Langeweile. Und ich war total überrascht, als ich merkte: Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich betrachte meine Abstinenz heute als Jackpot. Sie hat mir so viel ermöglicht. Mein Wort gilt wieder etwas, ich kann mich wieder auf mich verlassen, habe wieder Spaß an Bewegung und Begegnung, muss nicht mehr lügen und vertuschen, wache morgens mit klarem Kopf und reinem Herzen auf, gehe wieder mit Würde durch meine Tage. Nüchtern konnte ich erkennen, wer ich wirklich bin und welche Bedürfnisse ich wirklich habe. Darin liegt ein Schatz, eine Riesenchance.
Gratis Online-Programm
- Spiegel-Bestsellerautorin Nathalie Stüben, geboren 1985, promoviert an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (LMU München). Sie forschte bereits mit der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit Mannheim zu Abstinenzprogrammen.
- Im Netz bietet sie selbst ein niederschwelliges und breites Hilfsangebot (www.oamn.jetzt) an.
- Dort gibt es auch ein kostenloses Online-Seminar, in dem mit Mythen aufgeräumt und Menschen eine neue Perspektive auf ihren Alkoholkonsum vermittelt wird. Zudem gibt Stüben im Podcast „Ohne Alkohol mit Nathalie“ (www.oamn.jetzt/podcast) Tipps, auch auf dem gleichnamigen Youtube-Kanal.
Immer wieder wird deutlich, dass die Sucht vor allem erfolgreiche Frauen betrifft. Woran, denken Sie, liegt dieser Zusammenhang? Wie war es bei Ihnen?
Stüben: Darüber mache ich mir viele Gedanken, aber eine einfache, druckreife Antwort habe ich darauf noch nicht. Bei mir war Alkoholkonsum irgendwann auf jeden Fall eine Möglichkeit, mir Pausen zu gönnen. Ich war schon immer ehrgeizig, hatte schon immer Spaß an Arbeit und an Exzellenz. Und gleichzeitig hatte ich lange sicherlich auch einen Anspruch an mich, mit dem ich mich enorm unter Druck gesetzt habe. Außerdem verstehe ich heute: Ich mag Erfolg, ich mag Einsatz und Leistung, aber Konkurrenzdenken, Intrigen, Ellenbogen und Alphatierdenken belasten mich. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum so viele erfolgreiche Frauen trinken. Um diese Diskrepanz auszuhalten. Das ist aber nur eine These. Zumal viele erfolgreiche Männer ja auch süchtig sind.
Welche Rolle hat Ihrer Meinung nach Ihre Branche, der Journalismus, gespielt?
Stüben: Es ist ja kein Geheimnis, dass in der Medienwelt viel getrunken wird. Aber die Medienwelt ist da halt keine Ausnahme. Ärztinnen und Ärzte trinken, in der Pflege wird getrunken, unter Juristinnen und Juristen ist es verbreitet, im Handwerk, unter Hausfrauen (lacht). Also ja, meine Branche ist alkoholgetränkt, aber damit ist sie bei Weitem nicht allein.
Welches Gefühl gibt es Ihnen, nun selbst als Forscherin auf dem Themengebiet aktiv zu sein?
Stüben: Es ist spannend. Dadurch, dass ich eine völlig andere Zielgruppe erreiche, kann ich natürlich auch eine andere Zielgruppe befragen, ganz andere Daten liefern. Ich weiß noch, bei der Auswertung einer wissenschaftlichen Umfrage zu meinem 30-Tage-Programm kam zum Beispiel raus, dass meine Teilnehmenden zu rund 82 Prozent weiblich sind. Da sagte mein Doktorvater: „Den Wert musst du nochmal überprüfen, das kann eigentlich nicht sein.“ Es war aber so. Und mich hat es auch nicht so wahnsinnig überrascht, weil ich ja mitbekomme, wer meine Programme bucht. Aber diese Anekdote zeigt wahrscheinlich ganz gut, warum mir viel daran liegt, meine Reichweite auch für die Wissenschaft zu nutzen. Auch hier gibt es leider allzu oft eine verzerrte Wahrnehmung, die sich allzu sehr auf Extremfälle konzentriert.
Was erhoffen Sie sich von der Zusammenarbeit mit dem Mannheimer ZI?
Stüben: Ich arbeite aktuell ja hauptsächlich mit Falk Kiefer vom ZI zusammen. Wir schreiben gerade an einem gemeinsamen Buch. Von dieser Zusammenarbeit erhoffe ich mir Erkenntnisse, ein tieferes Verständnis dafür, inwieweit Frauen anders trinken – und inwieweit vielleicht auch nicht. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern? Diese Frage elektrisiert mich gerade, und ich glaube, diese Kooperation zwischen uns beiden liefert ein paar interessante Antworten darauf.
Definition Alkoholismus
Kriterien für Alkoholabhängigkeit sind laut WHO etwa, wenn mindestens drei der beispielhaft genannten Punkte in den letzten zwölf Monaten zutreffen:
- Starkes Verlangen oder eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren.
- Verminderte Kontrollfähigkeit, Alkohol wird in größeren Mengen oder länger als geplant konsumiert. Zudem erfolglose Versuche, den Konsum zu verringern.
- Ein körperliches Entzugssyndrom, wenn Alkohol reduziert oder abgesetzt wird.
- Trinken mit dem Ziel, Entzugssymptome zu mildern und der entsprechend positiven Erfahrung.
- Toleranzentwicklung: Für den gewünschten Effekt müssen größere Menge her.
- Fortschreitendes Vernachlässigen anderer Vergnügen/Interessen zugunsten des Alkohols.
- Anhaltender Konsum trotz (körperlich) schädlicher Folgen.
Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft, wenn Sie auf die Gesellschaft und den Umgang mit Alkohol blicken?
Stüben: Ich wünsche mir, dass wir Alkohol als das behandeln, was er ist: eine harte, toxische und gefährliche Droge. Ich habe kein Interesse daran, Alkohol zu verbieten. Aber wieso muss er im Supermarkt zwischen Nudeln und Milch stehen? Warum darf sogar im Umfeld von Grundschulen dafür geworben werden? Warum darf Werbung ihn ohne jeglichen Warnhinweis mit Bildern von Leichtigkeit und Jugend und Zugehörigkeit verknüpfen und uns dadurch suggerieren, dass er unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllt – obwohl gerade er so oft dafür verantwortlich ist, dass wir krank und einsam und depressiv und ängstlich werden? Warum sprechen wir im Zusammenhang mit Alkohol von „verantwortungsvollem“ Konsum? Wie absurd das ist, zeigen Begriffe wie „verantwortungsvoller Zigarettenkonsum“, „verantwortungsvolles Kiffen“ oder „verantwortungsvoller Kokainkonsum“. Ich wünsche mir, dass Alkohol seine Sonderstellung verliert und unser gesellschaftlicher Blick auf diese Droge die Realität stärker mit einbezieht.
URL dieses Artikels:
https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim_artikel,-mannheim-in-der-abstinenz-liegt-ein-schatz-eine-riesenchance-_arid,2113763.html
Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommentar Niederschwellige Alkoholsucht-Hilfsprogramme: Sowas von bitter nötig!